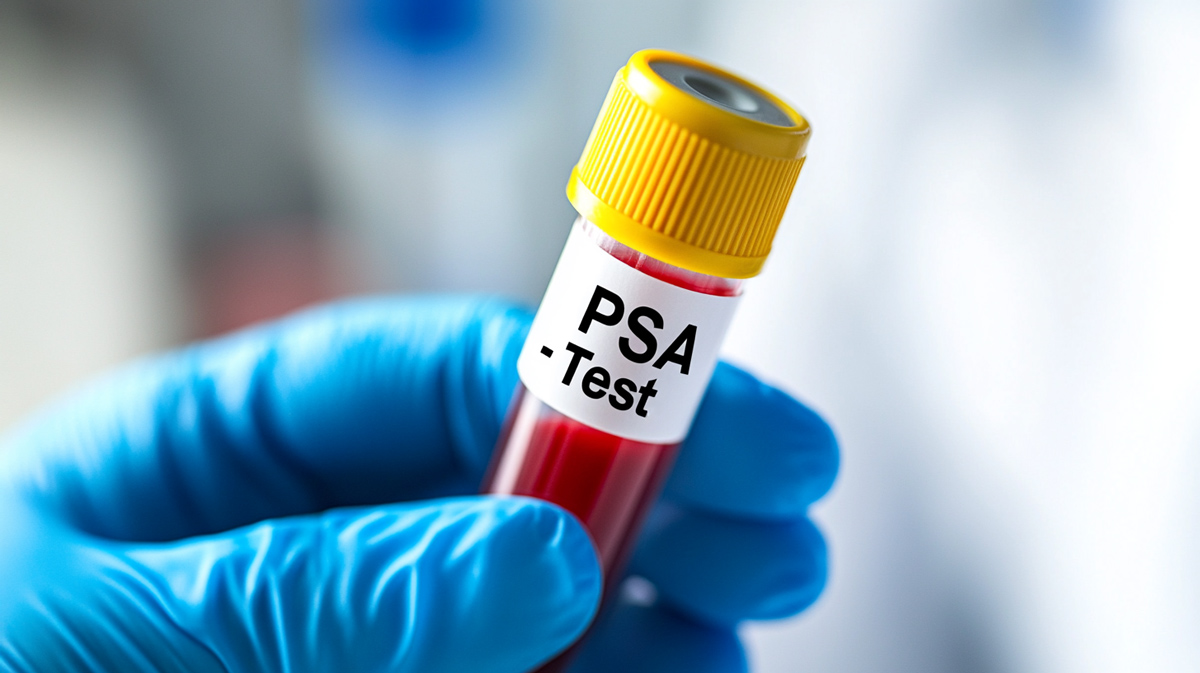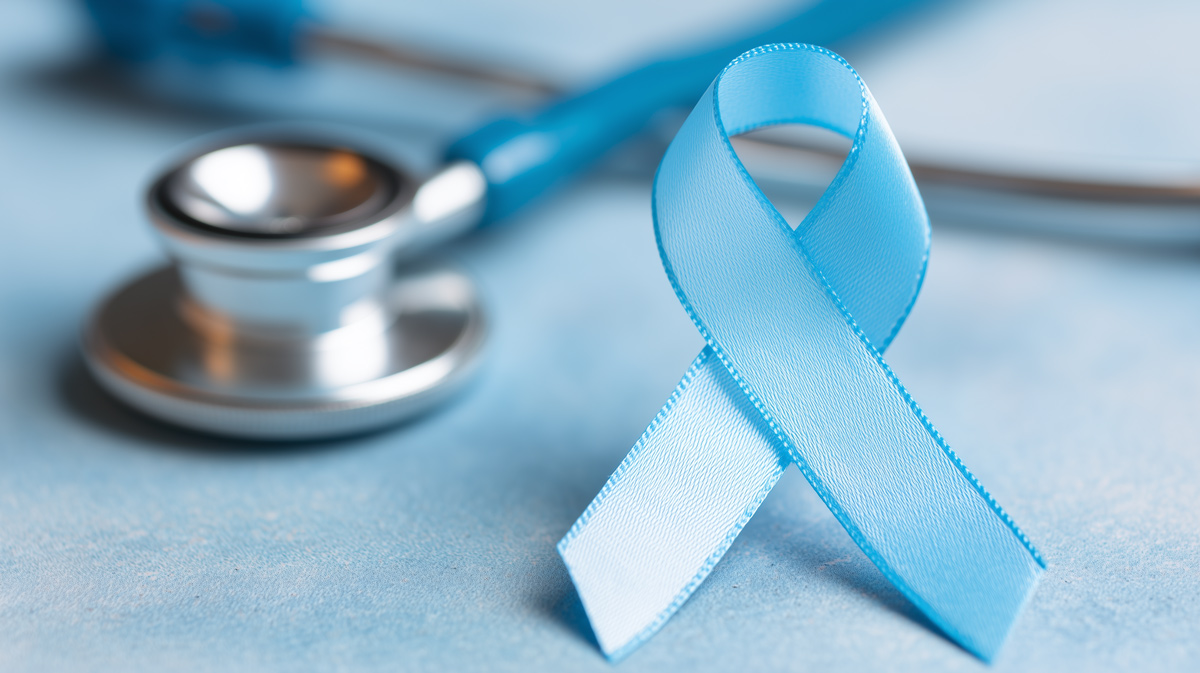Prostatakrebs verstehen: Warum der PSA-Wert so wichtig ist
Prostatakrebs ist mit etwa 70.000 Neuerkrankungen jährlich die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland, wobei der PSA-Wert eine zentrale Rolle in der Früherkennung und Diagnose spielt. Etwa 12.000 Männer versterben jährlich daran. Als Spezialisten für die Prostatakrebs Behandlung wissen wir, wie entscheidend die frühe Erkennung für den Therapieerfolg ist. Bei rechtzeitiger Erkennung ist Prostatakrebs in mehr als 70 Prozent der Fälle heilbar.
Besonders wichtig zu wissen: Prostatakrebs tritt meist bei über 50-Jährigen auf und wächst in der Regel relativ langsam. Die Rolle der Hormone, insbesondere des Testosterons, bei der Entstehung ist komplex. Zwar fördert Testosteron das Wachstum von Prostatakrebszellen, jedoch haben Männer auch bei einer Testosteron-Ersatztherapie kein erhöhtes Krebsrisiko. Ebenso entwickeln Männer mit niedrigen Testosteronwerten ebenfalls Prostatakrebs.
Was bedeutet der PSA-Wert konkret?
Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein Enzym, das ausschließlich von der Prostata gebildet wird. Seine eigentliche Funktion besteht darin, beim Samenerguss bestimmte Eiweiße zu spalten und das Ejakulat zu verflüssigen. Ein erhöhter PSA-Wert kann auf verschiedene Prostataerkrankungen hinweisen:
- Prostatakrebs
- Gutartige Prostatavergrößerung
- Akute Prostataentzündung
- Reizung der Prostata, z. B.. durch Manipulation (z.B. Blasenspiegelung nach Katheteranlage)
Wichtig zu beachten ist auch, dass bestimmte Medikamente den PSA-Wert erniedrigen können.
Früherkennung und Diagnose
In unserer urologischen Klinik empfehlen wir Männern ab dem 45. Lebensjahr regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Diese umfassen:
- PSA-Wert-Bestimmung
- Tastuntersuchung der Prostata
- Ultraschall der Prostata
- Weitere Diagnostik bei auffälligen Befunden
Erste Warnsignale für eine Prostataerkrankung können sein:
- Vermehrter Harndrang, besonders nachts
- Schwierigkeiten beim Urinieren
- Schwacher oder unterbrochener Harnfluss
- Erektionsstörungen
- Schmerzen bei der Ejakulation
Wann sollten Sie eine Abklärung auf eine Prostatakrebserkrankung in Betracht ziehen?
Bei auffälligen PSA-Werten. Hier spielt das Alter, die Größe der Drüse und die Entwicklung des PSA-Wertes über die Zeit eine wesentliche Rolle. Auch das Verhältnis von freiem PSA und Gesamt-PSA ist von Bedeutung. Der Einzelwert ist also nicht entscheidend, sondern die Einordnung in die Gesamtsituation.
Auffällige Tastbefunde oder ein auffälliger Ultraschall sollten ebenfalls Anlass für eine weitere Abklärung geben.
Wie erfolgt eine weitere Abklärung?
Wir können in unserer Klinik eine Mikroultraschalluntersuchung (ExactVu) der Prostata durchführen. Hierbei handelt es sich um ein hochauflösendes Sonographieverfahren mit 29 MHZ, das nur wenige Kliniken anbieten können. Die Auflösung ist so gut, dass sie unter Umständen ein Prostata-MRT ersetzen kann. Bei deutlichen Veränderungen im Mikroultraschall kann eine Biopsie ohne weitere Untersuchung erfolgen.
Alternativ oder ergänzend kann ein Stockholm3-Test zur individuellen Risikobewertung durchgeführt werden.
Das multiparametrische MRT der Prostata ist ein gutes Bildgebendes Verfahren zur Entdeckung von Veränderungen in der Prostata.
Sollten sich Auffälligkeiten finden, die auf eine Prostatakrebserkrankung hindeuten, ist eine Probenentnahme aus der Prostata angezeigt um eine Krebserkrankung festzustellen oder auszuschließen.
Am sinnvollsten geschieht dies durch eine Probenentnahme über den Dammbereich in Fusionstechnik. Dies ist bei uns Standard.
PSA nach einer Behandlung
Nach Lokaltherapie (Operation oder Bestrahlung) ist der PSA-Wert ein wichtiger Faktor zur Prüfung des Behandlungserfolges dar. Auch in der Behandlung von fortgeschrittenen Tumorsituationen spielt der Verlauf des PSA-Wertes eine große Rolle.
Am einfachsten zu werten ist der PSA-Wert nach Prostataentfernung. 3 Monate nach einer Prostatektomie soll der PSA unter 0,1ng/ml liegen und dort dann auch bleiben. Wenn er über 0,2ng/ml steigt spricht man von einem biochemischen Rezidiv, also Tumoraktivität nachgewiesen anhand des Blutwertes.
Nach Bestrahlung ist die Interpretation schwieriger. Da die Prostata noch im Körper ist fällt der PSA-Wert typischerweise nicht unter die Nachweisgrenze. Hier erwartet man einen sogenannten Nadir. Hiermit ist der niedrigste Wert, der erreicht wird, gemeint. Das Erreichen des Nadirs kann bis zu 2 Jahren dauern.
Erst wenn der PSA-Wert um mehr als 2ng/ml über den Nadir ansteigt, spricht man nach einer Bestrahlung von einem Tumorrezidiv.
Wichtig ist zu verstehen, dass die beiden Grenzwerte nach OP und Bestrahlung willkürlich gewählt und nicht gut wissenschaftlich begründet sind. Daher sind die Therapieergebnisse über diese Grenzwerte schlecht vergleichbar.
Vieles spricht dafür, dass der Anstieg um mehr als 2ng/ml nach Bestrahlung onkologisch zu hoch gewählt ist.
Daten aus der schwedischen Versorgungsforschung (in Skandinavien werden die Daten nach Behandlungen viel besser erfasst), zeigen dass der eigentliche wesentliche Endpunkt, die Krebssterblichkeit, niedriger für die Prostatektomie ist.
Bei metastasierten Tumorsituationen lässt sich ein Therapieansprechen nach systemischer Behandlung (Tabletten oder Chemotherapie) auch gut am PSA-Verlauf ablesen.
Fazit: Differenzierte Betrachtung des PSA-Wertes
Als erfahrene Spezialisten für Prostatakrebs Behandlung raten wir zu einer differenzierten Betrachtung des PSA-Wertes. Er ist ein wichtiger Marker, aber nie der einzige Entscheidungsfaktor für oder gegen eine weitergehende Diagnostik. Jeder Fall muss individuell betrachtet werden.
Vereinbaren Sie einen Termin in unserer urologischen Klinik in Düsseldorf, wenn Sie Fragen zu Ihrem PSA-Wert haben oder eine zweite Meinung wünschen. Mit meiner langjährigen Erfahrung in der roboterassistierten Chirurgie, der fokalen Therapie und der individualisierten Prostatakrebs-Behandlung stehen wir Ihnen gerne zur Seite.